Seit über einem Monat gibt es kein Lebenszeichen von Ralph. Ethel erinnert mich jeden Tag daran mit ihren geröteten Augen und ständigem Schluchzen. Sie kocht für meinen angeblichen Appetit, der wie der eines Pferdes sein soll, und bemerkt, dass ich zugenommen habe, obwohl alle anderen – einschließlich ihr und Vater – durch Sorgen und Stress abnehmen. Ihre Lieblingsfloskel „Und wegen dieser Lebensmittelrationierung…“ hallt immer wieder im Haus wider.
Vater wandelt wie ein Geist durch die Räume und sitzt dann stundenlang unbewegt da, während er Glen Miller hört – „Moonlight Serenade“ ist zurzeit sein Lieblingsstück. Diese Melodie durchdringt das Haus wie ein feiner Nebel und zerreißt uns das Herz. Die ständigen Luftalarmwarnungen zwingen uns zur Flucht in den Keller, der kalt und feucht ist wie eh und je. Manchmal nehme ich ein Buch mit und verliere mich darin, versuche mich an einen anderen Ort zu denken, während die Bomben mit ohrenbetäubenden Explosionen unsere geliebte Stadt vernichten. Die Häuser werden zu weißem Staub zermahlen, der Straßen, Wege und selbst das Grün in den Parks bedeckt. Die Angst wächst, dass von der Stadt bald nichts mehr übrigbleiben wird.
Immer wachsam warte ich auf den Postboten, auf seine festen Schritte im Garten, die mir einen Brief bringen könnten – ein Brief, der mich vielleicht aus dieser Lage herausführen wird. Allein in meinem Zimmer schreibe ich Richard, wie er es wollte. Ich erzähle ihm, dass ich bei den Schwiegereltern wohne, aber nach einer eigenen Bleibe suche. London ist ein einziges Trümmerfeld, und seit mehr als einem Monat gibt es keine Nachricht von Ralph. Ich gestehe ihm, dass ich ihn vermisse und mich sehr über einen Besuch freuen würde.
Kaum abgeschickt, finde ich tatsächlich eine Wohnung für mich. Beim Durchblättern der Zeitung, The Daily Express, stoße ich auf eine Anzeige. Ralph schwor auf diese Zeitung, die ihm jeden Tag von einem Zeitungsjungen zugestellt wurde, der nun nicht mehr mit dem Fahrrad, sondern zu Fuß mit einer Taschenlampe durch die Dunkelheit lief, um trotz Ausgangssperre seinen Weg zu finden. Die Wohnung liegt ein paar Meilen entfernt, über einem Lyon's Tea Room – einem teuren, aber angesehenen Ort. Es wäre ein bisschen wie Leben in der gehobenen Gesellschaft, und trotz der kleinen Größe mit einem Schlafzimmer, Wohnzimmer, Bad und winziger Küche ist es mir lieber, dort zu wohnen als bei Ethel und Ralph Senior.
An dem Tag, an dem ich packe, um auszuziehen, kommt ein Brief von Richard. Ich stehe extra früh auf, um den Postboten abzufangen, denn Ethel soll nicht sehen, dass ich Briefe bekomme, besonders nicht von einem anderen Mann. Richard schreibt mir, wie froh er ist, von mir zu hören, und dass er nie daran gezweifelt hat, dass das, was wir hatten, mehr als nur ein kurzer Sommerflirt war. Er erzählt von seinem Freund, einem Standesbeamten, der ihm vielleicht helfen kann, meine leibliche Mutter und vielleicht auch meinen Vater zu finden. Er hofft, mich bald in London zu besuchen, und freut sich auf unser Wiedersehen.
An einem Abend gehen wir zusammen in ein überfülltes, rauchiges Pub, in dem die Menschen dicht an dicht stehen, die Weihnachtslichter gedämpft leuchten und eine Sängerin in einem weißen Kleid mit strahlendem Lächeln einen traurigen, doch wunderschönen Song singt. Die Atmosphäre ist voller bittersüßer Melancholie – Soldaten tanzen mit Frauen in eleganten Kleidern, manche weinen vor Rührung. Richard und ich finden einen kleinen Tisch in der Ecke, und während wir gemeinsam „A nightingale sang in Berkeley Square“ singen, spüre ich die intensive Nähe und das Versprechen auf eine bessere Zukunft, trotz des Krieges, der unsere Welt zu zerstören droht.
Richard fragt mich, wie die Schwiegereltern reagierten, als ich ausgezogen bin. Ich erzähle von der frostigen Stille und dem Schluchzen, als ich die Tür schloss. Er versucht mich zu beruhigen, dass Ralph vielleicht wohlauf ist und nur keine Nachricht schicken konnte. Immerhin hätte ich ja noch keinen Telegramm erhalten.
Der Text zeigt eindrucksvoll, wie die Menschen inmitten des Chaos von Krieg, Zerstörung und persönlicher Unsicherheit versuchen, einen Funken Normalität und Hoffnung zu bewahren. Die Luftangriffe sind allgegenwärtig, zerstören nicht nur Häuser, sondern auch das seelische Gleichgewicht. Gleichzeitig zeigt sich die Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit und die verzweifelte Suche nach Stabilität. Die Kraft der kleinen Dinge – Musik, Briefe, ein neues Zuhause – gibt Halt und den Mut, weiterzumachen.
Wichtig ist zu verstehen, dass diese Geschichte nicht nur eine private Chronik des Krieges ist, sondern auch ein Spiegel der menschlichen Widerstandskraft und des Überlebenswillens. Die Menschen sind nie nur Opfer der äußeren Umstände, sondern stets auch Akteure ihres eigenen Schicksals, die trotz allem versuchen, Liebe, Nähe und ein bisschen Glück zu bewahren. Ebenso zeigt der Text die Bedeutung von Kommunikation und emotionaler Verbindung, die in Zeiten der Trennung und Ungewissheit lebensnotwendig ist. Die Rationierung, die Kälte in den Luftschutzkellern, die ständige Angst vor Verlust sind Rahmenbedingungen, die das soziale und emotionale Gefüge tief beeinflussen.
Der Leser sollte sich bewusst machen, dass Krieg nicht nur auf der Ebene von politischen oder militärischen Ereignissen stattfindet, sondern vor allem in den alltäglichen Geschichten von Menschen, die versuchen, ihre Identität und Menschlichkeit zu bewahren. Das Bedürfnis nach Hoffnung und Nähe, trotz des allgegenwärtigen Schreckens, ist ein zentrales Motiv, das sich durch die Erzählung zieht und für das Verständnis der Zeit unverzichtbar ist.
Wie der Krieg die Beziehung zu Ralph beeinflusste: Einblicke und Reflexionen einer jungen Frau
Der Kamin war mit allerlei Schnickschnack überladen – billige Souvenirs aus diversen Küstenorten und sogar ein kleines Töpfchen, das Ralph als Kind selbst gefertigt hatte. Die Eltern hingen an ihm. Eine ältere Schwester, Deidre, verheiratet mit Kindern – einem Jungen und einem Mädchen – aber selbst sie schienen nicht dieselbe Anziehungskraft auszustrahlen wie ihr Bruder Ralph. Ein Weihnachtsbaum stand in einer Ecke, tief im Schatten, und von der üblichen festlichen Helligkeit fehlte jede Spur.
Ich nickte gedankenverloren, als ich an Ethel und Ralph Senior dachte, die unerwartet freundlich unser Angebot abgelehnt hatten, Ralph zum Abschied zu begleiten, um uns diese kostbare Zeit allein zu lassen. Ich hatte mir diese Zeit alleine gewünscht, hatte gehofft, mich von etwas zu befreien, doch die Worte kamen nicht. Es war mir unmöglich, Ralph gegenüber Worte des Enttäuschens in Bezug auf unser gemeinsames Leben zu äußern – gerade jetzt, wo er in den Krieg zog.
Als mir eine Tasse Tee angeboten wurde, nahm ich sie entgegen, fügte einen Zuckerwürfel hinzu und trank einen Schluck. Der Tee war grausam heiß und verbrannte mir die Lippe.
„Er sagt, er wird bis Weihnachten zurück sein“, erzählte ich ihnen.
„Ha“, sagte Ralph Senior, setzte sich aufrecht hin und nahm einen Becher und eine Untertasse aus Ethels Händen. „Ich bezweifle das sehr.“ Er schüttelte den Kopf. „Das haben wir schon im Großen Krieg gedacht! Ach, wenn ich doch nur ein jüngerer Mann wäre, wäre ich jetzt mit unserem Ralph unterwegs, würde im Zug neben ihm sitzen, Witze reißen und Bier trinken.“ Er trank einen Schluck Tee und verzog das Gesicht. „Ugh, haben wir keinen Zucker?“
„Hier“, sagte Ethel, legte einen Würfel in seinen Tee und fügte dann hinzu: „Du hast deinen Teil im letzten Krieg getan, und du bist nie wieder derselbe gewesen.“ Sie schüttelte energisch den Kopf. „Nein, nie wieder derselbe. Und außerdem bist du jetzt zu alt.“
„Ich bin in Ordnung“, versicherte ihm Ralph Senior grimmig und rührte in seinem Tee, „Es liegt nicht am Alter. Wenn dieses Auge hier“, er zeigte auf das linke Auge, „noch in Ordnung wäre, dann würde ich…“
Ich musste innerlich schmunzeln – dies war ein Thema, das täglich durchgekaut wurde – und zog mich in meine Gedanken zurück. Jetzt, da Ralph fort war, fragte ich mich, was ich eigentlich tun würde. Ich konnte nicht länger hierbleiben, bei seinen Eltern. Ich musste meinen eigenen Weg gehen, sozusagen, und mir eine eigene Wohnung suchen.
Ich wusste, dass ich es schaffen konnte. Ich hatte einen guten Job und konnte mich selbst versorgen. Jeden Tag fuhr ich mit dem Bus nach Piccadilly, gut gekleidet in hohen Schuhen und Strümpfen, um in einem Büro zu tippen, Akten zu sortieren und das Telefon in einer sehr hochgestochenen Stimme zu beantworten. All die harte Arbeit, um mich zu verbessern, hatte sich ausgezahlt, und ich war froh, dass ich mit zwanzig Jahren so gut aufgestellt war.
Ralph hatte oft vorgeschlagen, dass ich meinen Job kündigen könnte, da er für uns beide sorgen könnte, aber ich war zögerlich, mochte meine Unabhängigkeit zu sehr, um sie aufzugeben.
Trotz allem durchzuckte mich ein Gefühl der Erregung bei dem Gedanken an ein Leben ohne Ralph, auch wenn es nur vorübergehend war. Zwei Monate einer hastig arrangierten Ehe wegen des drohenden Krieges hatten mir viele Dinge über meinen Ehemann gezeigt, und nicht alle waren positiv. Ich war bei seinen Eltern eingezogen und hatte zunehmend diese merkwürdige, fast übertriebene Bindung zu seiner Mutter bemerkt. Auch die anfängliche Anziehung zu seinen jugendlichen, guten Aussehen schwand täglich.
Ich war zu der Schlussfolgerung gekommen, dass ich einen großen Fehler gemacht hatte, doch was konnte ich tun? Das Sprichwort „Du hast dein Bett gemacht, jetzt musst du darin liegen“ ging mir immer wieder durch den Kopf. Aber wie müde ich war, Ralph zu hören: „Wir müssen nur noch ein wenig sparen, Rachel. Sobald wir genug für eine Anzahlung haben, besorgen wir uns eine eigene Wohnung.“ Hah, dachte ich, und er sagte, er könnte für uns beide sorgen.
Doch ohne dass er es wusste, hatte ich genug für eine eigene Wohnung, dank eines Erbes meiner Eltern und Geld, das ich heimlich gespart hatte – versteckt vor seinen neugierigen Augen. Ein Pfund hier, ein Shilling dort, ein paar Pennies… es summierte sich. Aber auch wenn ich es ihm anbot, er würde das Geld niemals annehmen – oh nein, nicht das Geld, das von mir, der kleinen Frau, gespart wurde.
Das Einzige, was mich noch zurückhielt, waren sie, die Schwiegereltern. Ich betrachtete sie heimlich – Ethel, eine große Frau, in ihrem üblichen Blumen-Schürzenkleid, hielt ein Taschentuch in der Hand und schniefte zwischen hastigen Teetrinkpausen. Ralph Senior, ein kleiner, eleganter Mann, mit einem dünnen Schnurrbart, der seine schwache Oberlippe verbarg, hatte die Augen geschlossen und lauschte der Musik. Sie wirkten wie ein ungleiches Paar, das mich an die immer beliebten Küstencartoons erinnerte, in denen eine große Frau einen kleinen Mann dominierte, ein Bild, das vermutlich auch ihre Beziehung widerspiegelte.
Ethels Stimme riss mich aus meinen Gedanken: „Rachel, möchtest du schon essen? Ralph und ich haben schon gegessen, wir wussten ja nicht, wie lange du brauchst. Dein Essen bleibt warm, ein schönes Leber- und Zwiebelgericht.“
Ich konnte den Gedanken an das Essen noch nicht ertragen, besonders nicht die Leber, die ich hasste. „Würdest du es mir ausnahmsweise bringen, ich gehe lieber in mein Zimmer. Ich bin wirklich müde.“
Ralph schüttelte traurig den Kopf. „Ihr jungen Frauen von heute, ihr esst nicht, viel zu dünn seid ihr. In meiner Zeit waren Frauen üppig, mit schönen Hüften und einer vollen Brust…“ Er formte mit seinen Händen die Luft.
„Ralph!“, sagte Ethel entsetzt, ihre Lippen geöffnet, die Wangen gerötet. „Rachel hat einen Schock erlitten. Ihr geliebter Ehemann ist in den Krieg gegangen.“ Dann wandte sie sich an mich: „Du geh ruhig hoch, ich bringe es dir später.“
Ich entkam aus dem Raum, ein Lächeln spielte auf meinen Lippen bei den Worten von Ralph Senior… üppig, wirklich! Ich war schlank, aber ich konnte wie ein Pferd essen und war stolz darauf. Ethels Worte… „geliebter Ehemann“. Wenn sie nur wüsste!
Ich eilte die Treppe hinauf, schlich über den abgenutzten, gestreiften Teppich und betrat unser Schlafzimmer. Das Doppelbett wirkte nun größer als je zuvor, beherrschte den Raum und war mit einer dicken, floralen Bettdecke bedeckt, flankiert von dunklen Holz-Nachttischen. Ein passender Kleiderschrank stand bündig an der Wand.
Vorsichtig verriegelte ich die Tür, kniete mich neben den Schrank und zog die Schublade auf. Ich griff in den Spalt und holte ein in Plastik gewickeltes Bündel heraus. Als ich es öffnete, breitete ich die Banknoten auf dem Bett aus, genoss den Anblick des Geldes und zählte es immer wieder, nur um sicherzugehen. Es war genug für die Anzahlung einer kleinen Wohnung, und ich dachte hart: Wenn Ralph zurückkommt und ich woanders wohne, dann kann er es mögen oder lassen! Entweder er kommt zu mir oder bleibt bei seinen Eltern. Jetzt, wo Ralph fort war, fühlte ich mich mutig.
Vorsichtig verstaute ich das Geld wieder an seinem sicheren Ort, holte ein Päckchen Zigaretten hervor, das ich sorgfältig unter einem Buch im obersten Fach des Schreibtisches versteckt hatte, und ging unruhig zum Fenster. Ich spähte zwischen den Vorhängen hindurch auf die dunkle, stille Nacht.
Ein großer heller Mond, umgeben von einigen Sternen, beleuchtete den Garten, sodass ich die schwarzen Silhouetten der Bäume gegen den Himmel erkennen konnte, und die Büsche sahen aus wie wollige Klumpen, die Menschen mit dickem, lockigem Haar ähnelten.
Ich steckte mir eine Zigarette an, öffnete das Fenster einen Spalt und atmete tief ein, während ich einen langen dünnen Rauchstrom ausblies. Der Duft der Nacht, erdig und kalt, stieg in meine Nase, und ich fragte mich, wo Ralph jetzt war und was er tat. Wurde er sofort kämpfen oder gab es eine Art Einführung, wie beim Anfang eines neuen Jobs?
Zahlreiche Gedanken wirbelten in meinem Kopf umher, der wichtigste darunter war: Würde er jemals zurückkommen und, falls ja, würde er den Krieg unversehrt überstehen?
Was bleibt in der Dunkelheit des Krieges?
Es war eine kalte Winternacht, und während ich draußen im Garten arbeitete, hörte ich plötzlich die Tür quietschen und eine vertraute Gestalt eilte auf mich zu. Die Dunkelheit hüllte den Garten ein, doch ich erkannte sie sofort, die Stimme, die mich einmal auf einem sonnigen Tag in den Feldern verzaubert hatte. „Cheryl?“ rief ich in die Stille, als sich ihre Silhouette näherte, die Arme ausgestreckt. Es war, als hätte sie keinen anderen Ort, an den sie flüchten konnte, keinen anderen Ort, an dem sie wirklich sein wollte. Ihre Eltern waren bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen, und sie stand nun vor mir, von der Verzweiflung gezeichnet, aber dennoch bei mir, in diesem Moment, der uns inmitten des Krieges einen Funken Trost schenkte.
Der Krieg, der alles beherrschte, nahm viele Formen an. Es war nicht nur der direkte Kampf an der Front, sondern auch der Kampf in den Herzen der Menschen, in den Ruinen ihrer Leben. Inmitten all dieser Dunkelheit, dieser ständigen Bedrohung, gab es Momente, in denen man an das Gute im Leben glaubte – wenn auch nur für einen kurzen Augenblick. Und dieser Moment war, als Cheryl bei uns auftauchte, ganz unerwartet. Es war Weihnachten, und trotz der düsteren Umstände hatte es einen Hauch von Wärme, den der Krieg kaum zu zerstören vermochte. Wir hatten ein Fest gefeiert, nicht aus Ignoranz, sondern aus einem tiefen Bedürfnis heraus, das Leben zu bewahren, selbst wenn es nur für eine Nacht war.
Die Luft war eisig, als ich die Fallen im Stall aufstellte, begleitet von Lucy, der Katze, die mir treu folgte und miaute, als ob sie wüsste, was ich tat. Es war eine seltsame Vorstellung – die Vorstellung, dass es immer jemanden gab, der sich um die kleinen Dinge kümmerte, um die Aufgaben, die oft als unbedeutend angesehen wurden. Doch Lucy war da, als ob sie mir sagen wollte, dass sie die Verantwortung für das, was zu tun war, übernehmen würde. „Zu spät, Lucy“, murmelte ich, als ich die Fallen in den Strohballen versteckte. Frederick hatte das Vertrauen in sie verloren, und er verlangte nach einer Lösung, nicht nach Miau.
In den Tagen und Wochen, die folgten, verschwand das Vertrauen, das man früher in Dinge setzte, mehr und mehr. Der Krieg hatte alle Facetten des Lebens durchdrungen, selbst die kleinen Momente des Friedens. Und doch, in all dem, was uns umgab, war es die Familie, die mich tröstete. Trotz der ständigen Sorge um Richard, der irgendwo an der Front kämpfte, blieb ich mit den anderen, mit denen ich jetzt meine Familie nannte, vereint. Und als Cheryl zu uns kam, fand sie nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch das Gefühl von Zugehörigkeit, von einem Ort, an dem man inmitten des Chaos wieder atmen konnte.
Während wir die Kriegsnachrichten hörten, die von den Erfolgen der Alliierten berichteten, von der Niederlage Hitlers und dem Ende seiner Träume eines „Tausendjährigen Reiches“, blieb Cheryl ruhig. Sie hatte so viel verloren, doch in ihr war eine Stärke, die sie trug. Der Krieg hatte die Welt zerstört, die Welt, wie wir sie kannten. Aber es hatte nicht die Fähigkeit der Menschen zerstört, miteinander zu verbinden, zusammenzuhalten und die Dunkelheit zu überstehen.
Der Krieg endete nicht nur mit der Niederlage des Feindes. Es endete mit der Erkenntnis, dass in den kleineren, oft unscheinbaren Momenten – wie der Moment, als Cheryl bei uns auftauchte – die wahre Bedeutung des Lebens lag. Denn der Krieg nahm nicht nur das Leben vieler, sondern auch viele Erinnerungen, viele Träume und die Hoffnung. Doch die Hoffnung, die in den Herzen derer weiterlebte, die noch übrig waren, war stärker als der Krieg. Sie bestand in der Fähigkeit, in der Dunkelheit des Krieges nach einem Funken Licht zu suchen.
Was bleibt also von all dem? Was bleibt nach all dem Leid, nach all den Jahren des Krieges und der Zerstörung? Vielleicht ist es genau das – die Erkenntnis, dass die Momente der Verbundenheit und des Trostes die wahren Werte sind, die den Krieg überdauern können. In den Gesichtern derer, die übrig bleiben, in den einfachen Handlungen der Fürsorge und des Miteinanders, in der Wärme des Feuers, das uns zusammenbringt, auch wenn draußen der kalte Wind weht.
Wie sollte man hochintensive Intervalltrainings (HIIT) und flexible Ernährungspläne richtig kombinieren?
Wie bringt man Hunden bei, mit Spielbällen Tricks zu machen?
Wie beschreibt man Unterkünfte und Umgebung auf Deutsch richtig?
Wie bahnbrechende Entdeckungen die moderne Wissenschaft und Technik prägten
Wie verständigt man sich als Reisender auf Arabisch in Alltagssituationen?
Wie pflanzt man Dahlien in gemischte Beete, ohne dass sie dominieren?
Wie eine kleine Hilfe die Welt verändern kann: Die Abenteuer von Ramu, dem Taxi-Jungen

 Deutsch
Deutsch
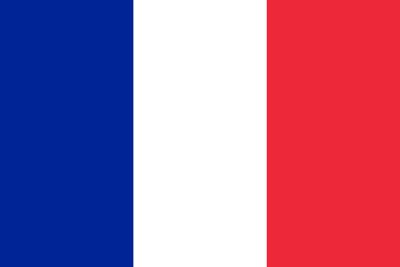 Francais
Francais
 Nederlands
Nederlands
 Svenska
Svenska
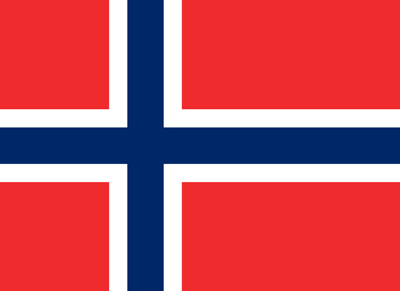 Norsk
Norsk
 Dansk
Dansk
 Suomi
Suomi
 Espanol
Espanol
 Italiano
Italiano
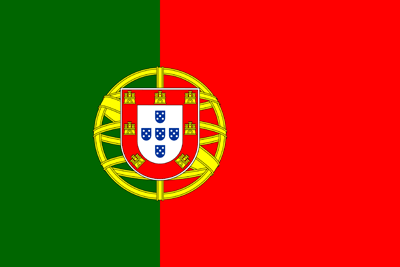 Portugues
Portugues
 Magyar
Magyar
 Polski
Polski
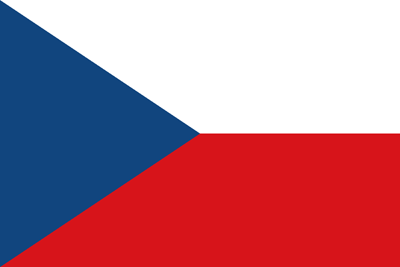 Cestina
Cestina
 Русский
Русский